Die Ankunft des Sterns
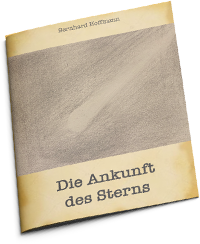
Sie saßen nebeneinander auf dieser übernatürlich grünen Wiese, die sich sanft den Hügel hinab ins Tal zog. Sie leuchtete im Schein der Sonne, tanzte zum Gesang der Vögel; der Wind blies sanft durch die nahen Wälder und ließ die Bäume flüstern.
Anna hielt die Hand ihrer großen Schwester, während sie angestrengt in den Himmel sah. Langsam hob sie ihre kleine Hand und deutete nach oben. „Ist er das?“ Johanna blickte hinauf, sah dann ihre kleine Schwester an und nickte. „Ja, das ist er.“
„Der Stern“, sagte Anna leise und senkte den Kopf.
Es war Mittag und für Mitte Mai angenehm warm. Sie waren allein, auch die nähere Umgebung war menschenleer. Der Bauernhof links unten in einer Senke war schon vor Wochen verlassen worden. Auf den Straßen regte sich nichts. Auch Mittersill, die nächste größere Stadt, war längst geräumt worden. Zunächst hatten sich noch Plünderer bedient, Brände waren ausgebrochen, aber letztendlich war die skelettierte Kleinstadt einfach aufgegeben worden. Es gab Wichtigeres zu tun – und nichts mehr zu retten.
Begonnen hatte es vor einem knappen Jahr mit der Entdeckung des Asteroiden 2017 FW12 durch einen australischen Astronomen. William Jones besaß sein eigenes kleines, privates Sternwarte etwas außerhalb von Armidale, auf einem Grundstück, das schon seinen Großeltern gehört hatte. In einer Scheune hatte er seinen Jugendtraum verwirklicht und ein geradezu gigantisches Teleskop aufgestellt. Jede freie Minute verbrachte er hinter dem Okular und beobachtete den Himmel. Und vor knapp einem Jahr hatte er etwas entdeckt, das wie ein schmaler Riss, ein Spalt im ewigen Raum aussah. Er beobachtete es nächtelang, stellte Berechnungen an und korrespondierte mit anderen Observatorien. Bald war klar: Dies war ein außergewöhnlicher Asteroid. Und William Jones, dem Entdecker, war zum Feiern zumute.
Die Freude verging allerdings rasch, als die Flugbahn berechnet wurde. Der außergewöhnliche Himmelskörper, dem Jones aufgrund seines verbogenen, scheibenförmigen Aussehens den Spitznamen „can top“, also Dosendeckel, gegeben hatte, raste direkt auf die Erde zu. Auf Kollisionskurs. Und angesichts der Größe und Geschwindigkeit des Asteroiden verging William Jones jegliche Lust aufs Feiern.
Der ersten Veröffentlichung, die im Internet schnell ihre Verbreitung fand, folgte reflexhaft die politische Verharmlosung. Man wisse noch nichts Genaues, man überprüfe noch. Aber diese schwammigen und oberflächlich beruhigenden Statements wühlten die Menschen nur noch mehr auf. Aus einer Geschichte wurden Vermutungen, aus Vermutungen Gerüchte, und diese begannen Menschen allerorts, langsam, aber sicher in Panik zu versetzen, denn die durch tausendfache stille Post übermittelte Nachricht lautete: Ein Asteroid wird auf die Erde stürzen und die Menschheit vernichten.
Es blieb der UNO in Person ihres Generalsekretärs António Guterres vorbehalten, die Fakten auf den Tisch zu legen: Der Asteroid, dem man den klingenden Namen „Fortis“ gegeben hatte, würde in 335 Tagen auf der Erdoberfläche einschlagen, und zwar in Zentraleuropa.
António Guterres führte in seiner väterlichen Art aus, dass dies nicht unbedingt das Ende der Menschheit bedeuten müsse und bereits die besten Wissenschaftler weltweit daran arbeiteten, den Asteroiden zu stoppen oder zumindest weit genug abzulenken, sodass er die Erde verfehlte.
Die Lösungsansätze, das faktisch einzige Thema sämtlicher Medien in den folgenden Monaten, waren ebenso unterschiedlich wie bizarr:
• ein atomarer Sprengsatz
• eine Beeinflussung der Flugbahn durch das Anbringen von Düsenaggregaten
• Störobjekte, die vor den Asteroiden geschossen werden, um seine Bewegung zu verändern
• ein kompliziertes Spiegel-System, um die Energie der Sonne zu bündeln und damit eine Seite des Asteroiden so zu erhitzen, dass sich seine Flugeigenschaften verändern
Trotz der internationalen Bemühungen steigerte sich das Crescendo der weltweiten Unruhe mit jedem Tag, der dem 13. Mai 2018 – dem Tag des Einschlags – näher kam. Politiker versuchten zu beruhigen, Populisten schürten das Feuer der öffentlichen Hysterie, das sich nur allzu leicht entfachen ließ. Die Börsenkurse fielen ins Bodenlose, schließlich wurde der Handel ausgesetzt. Es war eine Blütezeit für Religionen und Sekten. Und es schien, als ob angesichts einer möglichen globalen Katastrophe viele moralische Hemmungen einfach fallen gelassen würden. Die Kriminalität stieg und mit ihr das Ausmaß an staatlicher Gewalt beim Versuch, ihr Herr zu werden.
Während die NASA mit russischer und chinesischer Unterstützung eine Mission vorbereitete, die eine mögliche Ablenkung des Asteroiden zum Ziel hatte, wurde unter der Leitung der UNO die Evakuierung von Europa geplant; bei aller Hoffnung auf ein Wunder oder einen Geistesblitz aus den Thinktanks und Labors in Amerika, Europa und Asien – man wollte, man musste sich auf den Ernstfall vorbereiten.
In den darauf folgenden Monaten begannen 700 Millionen Europäer, in alle Teile der Welt auszuwandern. Während im vergangenen Jahrhundert Millionen Migranten ihr Glück in Europa gesucht hatten, überfluteten nun Massen an Europäern ihrerseits Afrika, baten um Aufnahme in den USA und Kanada, wollten ihre neue Heimat in Südamerika finden oder nach Asien emigrieren. Niemand wusste, wie viel damit eigentlich zu gewinnen war, ob die lebensnotwendigen Strahlen der Sonne eine postapokalyptische, verstaubte und nachtdunkle Atmosphäre überhaupt noch durchdringen können würden – oder die Massenflucht den sicheren Tod nur um einige Wochen oder Monate hinauszögerte. Das allein genügte freilich, um Scharen von verzweifelt Hoffenden zu Flüchtlingen zu machen – je weiter weg von Europa, desto besser.
All das hatte Johanna ihrer Schwester erzählt, hatte sie dabei im Arm gehalten und mit ruhiger Stimme erklärt, was zu tun sei.
„Was ist das, ein Asteroid?“, hatte die Kleine gefragt.
Johanna hatte überlegt, in den Abendhimmel gedeutet und dann geantwortet: „Das bedeutet, dass uns ein Stern besuchen kommt.“
Anna hatte große Augen gemacht und gefragt, warum alle Menschen davor Angst hätten. Johanna hatte es ihr erklärt, Anna hatte geweint, auch wenn sie nicht recht wusste, warum, und sich schließlich von ihrer großen Schwester trösten lassen. Ihre Schwester, ihre große Schwester war ihr Ein und Alles. Ihre große Schwester wusste, was richtig und gut war.
Anna und Johanna waren immer schon unzertrennlich gewesen.
„Wenn wir groß sind, schreiben wir einmal ein Buch über uns“, pflegte Johanna zu sagen. „Weil wir die besten Schwestern der Welt sind!“
Die siebenjährige Anna hatte genickt und begonnen, Zeichnungen für dieses Buch zu machen. Jetzt lagen sie in einer gelben Sammelmappe in ihrem Biene-Maja-Rucksack, der neben ihr in der Wiese stand. Ein Käfer, dunkel und schillernd, kletterte langsam über die neongelbe Naht auf der Seite hinauf. Anna beobachtete ihn.
„Ich mochte Käfer“, sagte Anna und blickte auf das Tier, das sich immer noch langsam den Rucksack hinaufmühte.
„Du magst sie ja noch immer, oder?“
Sie verzog das Gesicht. „Ja, schon, aber …“
Der Satz verlor sich in der Weite des Tals, während sich die Sonne langsam zu senken begann.
Johanna wusste nicht recht, was sie sagen sollte. Seit sie Anna das erste Mal davon erzählt hatte, war „der Stern“, wie Anna den Asteroiden nun bezeichnete, immer wieder ein Thema gewesen.
Natürlich hatte sich die Familie, hatten sich fast alle in ihrer Umgebung bis zum Moment der Evakuierung geweigert, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Die Kühe wurden weiter gemolken, die Raten für den neuen Scheunenanbau weiter überwiesen. Zu allem Überfluss hatte ihre Mutter sie auch noch gezwungen, am Sonntag mit in die Kirche zu gehen. Die Frage, warum Gott einen Asteroiden schickt, wenn er sie doch alle so lieb hätte, hatte ihr eine schallende Ohrfeige von ihrer Mutter eingebracht.
„Wird es weh tun?“
Annas Frage riss sie aus ihren Gedanken. Sie blickte ihre kleine Schwester an.
„Es wird nicht lange dauern“, antwortete sie schließlich und bemühte sich um eine sichere Stimme. „Kannst du dich noch erinnern, wie du dir voriges Jahr den Arm gebrochen hast?“
Anna nickte.
„Viel kürzer als damals.“ Es klang fast aufmunternd. Aber eben nur fast. Und dann fügte sie hinzu: „Und ich werde dich die ganze Zeit ganz, ganz fest halten!“
Das schien zu helfen, denn Anna entspannte sich etwas und blickte einem
Greifvogel nach, der weit oben seine Bahnen zog.
„Werde ich Opa wiedersehen?“
Auch diese Frage kam aus dem Nichts, Anna hatte ihren Blick nach wie vor auf den Himmel gerichtet.
Darauf wusste Johanna wirklich keine Antwort.
„Ich … weiß es nicht“, sagte sie leise. Sie wollte ihr keine Lügen erzählen. Wenn jetzt nicht der Zeitpunkt für Offenheit gekommen war, wann dann?
Johanna versuchte noch ein Lächeln, dann nahm sie ihre geliebte kleine Schwester in den Arm.
Bevor sie ihren Hof verlassen hatten, war sie noch einmal in den Stall, hatte die Tiere gefüttert. Sie hatte sich von ihnen verabschiedet, ihre kleine Schwester an der Hand genommen und war hier herauf gegangen. Sie befanden sich in der Todeszone, genau jenem Bereich, in dem der Einschlag erfolgen würde. Hier, dachte sie, geht es am schnellsten. Hier ist es dann ganz sicher vorbei.
Und das war auch gut so.
Seit sie denken konnte, gab es aus der ganzen Welt fast nur Schlimmes zu berichten. Egal, ob sie ins Internet, ins Fernsehen oder auch nur hinter die Fassaden der näheren Verwandtschaft schaute: Überall gab es Konflikte, Streit, Gewalt, wurde die Umwelt vergiftet, vernichtet, ausgebeutet, sei es in den Aluminiumwerken Südostasiens, den Ölschieferfeldern Kanadas, gigantischen Gentech-Mais-Monokulturen oder lebensvernichtenden Palmölplantagen.
Seit Jahrzehnten war bekannt, dass die Menschen die einzige Heimat, die sie je haben würde, in eine leblose, unbewohnbare Kloake verwandelte. 2022 wären es 50 Jahre geworden, dass der „Club of Rome“ die „Grenzen des Wachstums“ aufzeigte. Über zehn Jahre war es her, dass Al Gore den Film „Eine unbequeme Wahrheit“ veröffentlicht hatte. Und was wurde getan?
Nichts.
Im Gegenteil: Während die Superreichen, deren Vermögen schon lange psychopathische Ausmaße angenommen hatte, noch reicher wurden, lebte eine Milliarde Menschen unter der Armutsgrenze. Tausende verhungerten in einer Welt des Überflusses jeden Tag, während in den Industrieländern Lebensmittel vernichtet wurden, um deren Preise zu stützen. Gesetze, so schien es, wurden nur noch dafür gemacht, um diese Schere noch weiter auseinandergehen zu lassen. Und obwohl dies sogar einer stetig wachsenden Zahl an Menschen in den Industrieländern, denen es vergleichsweise gutging, nicht gefiel, geschah nichts, um dies zu ändern.
Ihr Vater sagte in regelmäßigen Abständen: „Ja, die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, das sag’ ich euch!“ Wie sich zeigte, hatte er recht damit.
Es war, als ob die Welt mit Blindheit geschlagen, mit Gier vergiftet und mit Ratlosigkeit gelähmt worden war. Und Johanna dachte nicht zum ersten Mal: Wozu in einer Welt leben, die eigentlich schon untergegangen ist? Warum das Leiden, das nur noch zunehmen kann, noch hinauszögern? Warum davonlaufen, wenn die Lösung doch darin bestand, stehenzubleiben, sich in die schöne, grüne Wiese zu setzen und einfach zu warten?
Als Johanna ein Kind gewesen war, hatte sie noch an Gott geglaubt. Heute tat sie das nicht mehr, aber vor einigen Tagen hatte sie zum Himmel geblickt und überlegt: Wenn es einen Gott gibt, dann ist er jetzt gerade auf dem Weg zu uns.
Es war nicht schwer gewesen, ihre Eltern abzuhängen. Die Ausreisemöglichkeiten waren begrenzt, und eine entfernte Verwandte aus den USA hatte angeboten, sie aufzunehmen. Im größten Trubel hatte sie am Flughafen Salzburg vorgegeben, die Tickets für sich und Anna verloren zu haben. Ihre Mutter war hysterisch geworden, ihr Vater hatte versucht, ihre Plätze für die Kinder einzutauschen. Der Zeitdruck, die restriktiven Ausreiseregeln und der Druck der anderen Passagiere zwangen die Eltern, die Kinder zurückzulassen und mit einem späteren Flug zu erwarten. Sie würden mit anderen Verwandten, die ebenfalls in die USA flüchteten, nachkommen, hatten sie versichert.
Doch die warteten vergebens auf die beiden Nichten. Johanna hatte ihre Verwandten nicht aufgesucht. Sie war auf abenteuerliche Weise mit ihrer kleinen Schwester zurück zum Hof gelangt. Sie wollte hier bleiben, genau hier. Weil es egal war, nein: Weil es gut und richtig war.
Fortis würde in der unmittelbaren Umgebung ihres Heimatorts einschlagen. Die darauf folgende Druckwelle würde hunderte Kilometer im Umkreis in kürzester Zeit in eine unbelebte Wüste verwandeln. Die Alpen würden diese erste Druckwelle gegen Süden hin etwas aufhalten, letztendlich wären aber auch diese Gebiete von den Folgen genauso betroffen wie alle anderen.
Johanna kniff die Lippen zusammen. Je älter sie geworden war, desto weniger hatte sie verstanden, wie man in dieser Welt leben, geschweige denn Kinder in sie setzen konnte. Sie war 18 Jahre alt, sie gehörte zur Generation, die die Auswirkungen des Klimawandels miterleben würde. Aber nicht nur das entzog ihr jeden Lebensmut, es war etwas, was noch viel gefährlicher war als der globale Anstieg der Temperatur und die damit verbundenen Folgen: Es war die menschliche Natur. Es war die offensichtliche Ignoranz der Wenigen, jener, die es in der Hand hatten, das Ruder herumzureißen und es eben nicht taten. Es war aber auch das Denken der normalen, einfachen Menschen, die nicht einsahen, warum sie sich den Urlaub in der Karibik verkneifen, kein Plastik verwenden und vielleicht nicht jeden Meter mit dem Auto fahren sollten. Kleinliche Alltagsvorteile kamen vor der Natur, vor jedem rationalen Denken und dem berühmten Blick über den Tellerrand.
Es war die Unmöglichkeit, dagegen etwas zu tun, nur existieren zu können und dabei zusehen zu müssen, wie das große Experiment „Mensch“ einem jämmerlichen Versagen entgegengesteuert wurde. Unter dem so viele leiden würden.
Unschuldige Menschen.
Menschen wie sie.
Und vor allem Menschen wie ihre kleine Schwester Anna.
Sie sah zum Himmel. Der Punkt wirkte größer. Die Luft schien sich zu verdichten. Die Geräusche der Natur ebbten ab. Bald würde ein Schweigen einsetzen, dem der große Donner folgen würde.
Dann wäre es vorbei. Und ihre kleine Anna hätte kein Leben mehr vor sich, in dem sie in Depression und Verzweiflung dabei zusehen müsste, wie die Menschheit für ihre Ignoranz einen erbarmungslosen, einen endgültigen Preis zu zahlen hatte.
Anna war zu klein, um so eine Entscheidung zu treffen. Deshalb hatte sie für ihre kleine Schwester entschieden. Ein Tod in der liebevollen Umarmung, wie sie nur Schwestern einander geben können, war einem Leben ohne Wert und Würde jedenfalls vorzuziehen.
Die Vorhersagen waren über das Jahr wiederholt revidiert worden. Die letzten Berechnungen hatten ergeben, dass der Einschlag vor allem Zentraleuropa für zwei bis drei Jahre unbewohnbar machen würde. Die globalen Auswirkungen waren schwer abzuschätzen, doch optimistische Voraussagen sprachen davon, dass sich Amerika, Asien, Australien und Afrika in Sicherheit wiegen konnten. Natürlich würden auch sie von der unvermeidbaren Staubwolke in der Atmosphäre betroffen sein, aber mit sorgfältiger Planung und Rationierung der bereits angelegten Lebensmittelvorräte dürfe man von einer relativ geringen Zahl an Todesopfern ausgehen – zumindest im Vergleich zu einer globalen Katastrophe.
Als Johanna das gehört hatte, hatte sie sich nicht gefreut. Sie war nur stumm dagesessen, hatte den Fernseher angestarrt und hatte nicht verstanden, warum ihre Eltern sich um den Hals gefallen waren. Denn instinktiv wusste sie, was danach geschehen würde, nachdem die prognostizierten Jahre der Verwüstung und globalen Schwierigkeiten vorbeigegangen sein würden:
Nichts.
Es würde alles beim Alten bleiben. Die Menschheit würde nach einem kurzen Moment des Innehaltens weiter mit Blick auf das Smartphone auf den Abgrund zutaumeln und mit den guten Vorsätzen auch gleich die Menschlichkeit zu Grabe tragen.
Der Himmelsbote hätte eine Botschaft gesendet, die niemand verstehen – nein –, die niemand verstehen wollen würde. War es also nicht viel besser, hier und jetzt ein Ende zu machen, als danach, nach dem Einschlag, dem Siechtum einer ignoranten Menschheit und dem allgemeinen Absterben des Lebens an sich zusehen zu müssen? Lieber jetzt in vollem Bewusstsein dem Asteroiden ins Auge zu sehen als danach verzweifelt um die letzten Ressourcen zu kämpfen und zuzusehen, wie Unmenschlichkeit und Dummheit um den ersten Platz beim Untergang der Menschheit ritterten? Denn so würde es kommen, daran zweifelte sie nicht.
Sie stand auf und streckte Anna ihre Hand hin.
„Wollen wir vielleicht noch ein wenig in den Wald?“
„Au ja!“, meinte die Kleine und sprang auf. „Gehen wir zum hohlen Baum?“
Johanna lächelte. „Ja. Und vielleicht, wenn wir ganz ruhig sind, können wir ein paar Tiere beobachten.“
Anna wollte ihren Rucksack aufheben, aber Johanna schüttelte den Kopf. „Wir kommen ja hierher zurück. Und ich glaube nicht, dass die Murmeltiere ihn stehlen werden!“
Anna kicherte bei der Vorstellung, wie die kleinen Tiere mühsam das bunte Ding über die Wiese zogen. Dann ergriff sie die Hand ihrer großen Schwester und stapfte los.
Fünf Stunden später erfolgte der Einschlag. Die Druckwelle vernichtete nicht nur Flora und Fauna in der gesamten Region, sondern zerfetzte mit wütendem Gebrüll alles, was je von Menschenhand gebaut worden war.
Kurz hatte Anna geschrien und sich an Johannas Brust geklammert, bevor es auch schon vorbei war. Im Bruchteil einer Sekunde waren sie, ihre Schwester, die Picknick-Decke, der Biene-Maya-Rucksack und die Zeichnungen für ihr gemeinsames Buch in Stücke gerissen und in der Staubwolke, die mit Überschallgeschwindigkeit weiterraste, verteilt worden. Danach war es still geworden. Totenstill.
* * *
CNN berichtete über die Lage in der alten Welt. Die Atlantikküste Europas war verschont geblieben. In Osteuropa hatte es kaum direkte Schäden gegeben, wenngleich es von der riesigen Staubwolke, die sich unaufhaltsam ausbreitete, am schwersten betroffen war. Dazwischen aber lebte nichts mehr: Wieder und wieder zeigten Luftaufnahmen den riesigen Krater, der aussah, als ob ein wütender Riese mit seiner Faust in die Nordalpenseite geschlagen hätte, genau dorthin, wo vor kurzem noch ihr Zuhause gewesen war.
Elisabeth Holzinger, die mit ihrem Mann Unterschlupf bei Verwandten in den USA gefunden hatte, starrte auf ihr Mobiltelefon, wie sie es die vergangenen fünf Tage seit dem Einschlag fast ständig getan hatte. Sie seufzte, während ihr eine Träne die Wange hinablief.
„Ich vermisse euch“, sagte sie leise. „Wo seid ihr?“
Aber sie wusste die Antwort darauf. Was sie nicht wusste: Ob sie jemals die Kraft aufbringen würde, sich diese Antwort einzugestehen und ihr Leben fortzuführen.
Im Hintergrund lief der Fernseher weiter. „Natürlich ist die Lage katastrophal“, meinte ein Analyst lakonisch. „Aber man muss nach vorne sehen. Es wird ein, zwei Jahre dauern, bevor Europa wieder aufgebaut werden kann. Aber das ist auch eine Chance, die Dinge neu zu machen, richtiger zu machen. Bessere Infrastruktur für die Wirtschaft aufzubauen. Intelligentere Wege zu finden.“
Der Mann lächelte die Interviewerin an. „Und sie werden sehen: In fünf Jahren ist alles wieder gut, und wir können unser Leben weiterleben, wie wir es schon immer gemacht haben.“
